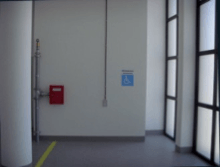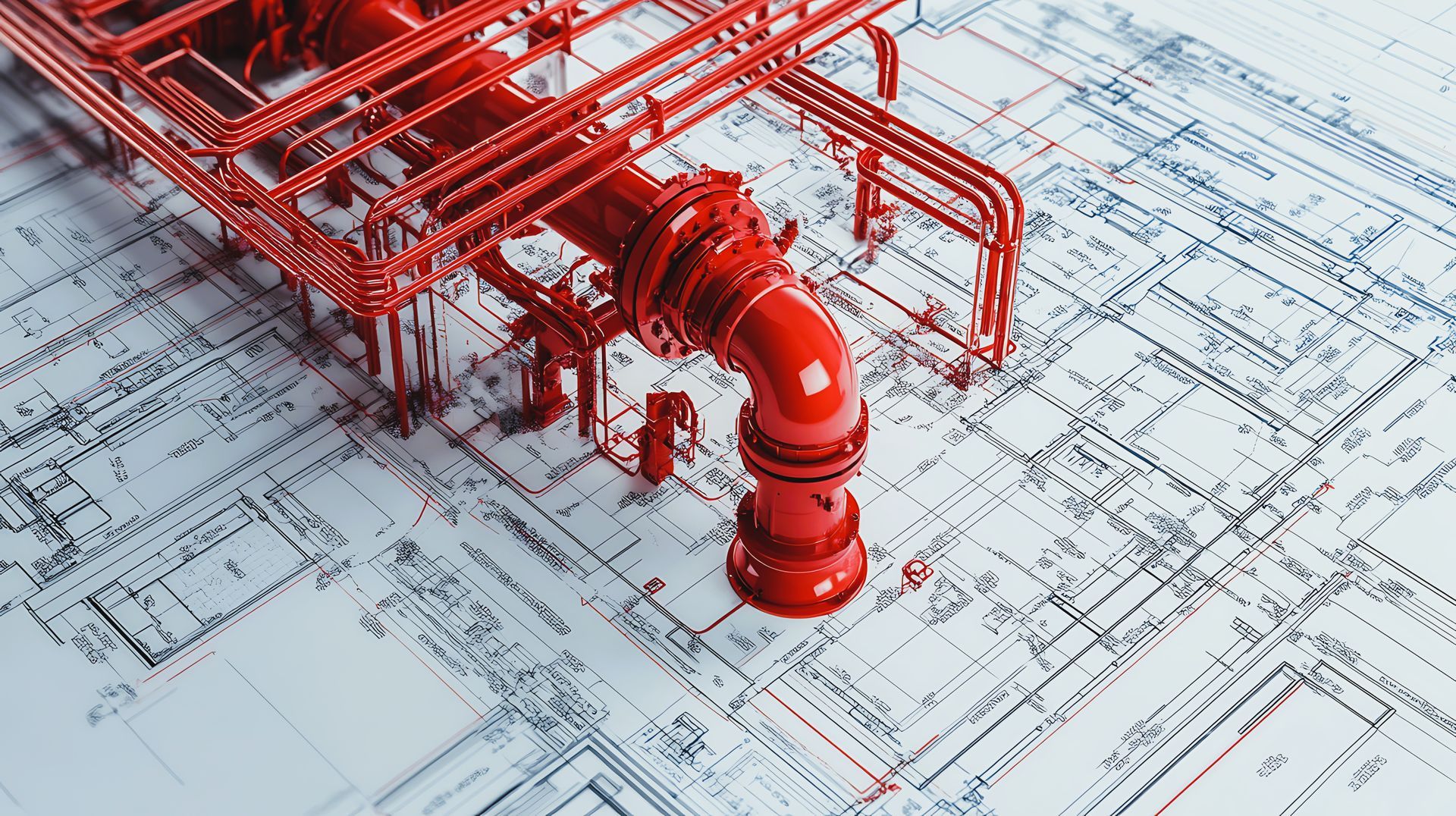Inklusion und Barrierefreiheit in öffentlichen Einrichtungen ist immer wieder Gegenstand kontroverser Diskussionen – von der Planung, über die Genehmigung bis zur Nutzung. Davon betroffen sind auch Museen, Bibliotheken und Archive. Für den Brandschutz ergibt sich hinsichtlich der Evakuierung im Bedarfsfall eine besondere Perspektive auf das vielschichtige Thema, das nicht auf Menschen im Rollstuhl reduziert werden darf. Dazu einige Anmerkungen.
Barrieren bei der Evakuierung (Auswahl)
Die gesellschaftlich geforderte Zugänglichkeit öffentlicher Gebäude und aller ihrer Teile bzw. Geschosse ist u.a. in den Landesbauordnungen festgelegt und wird für den funktionalen Nutzungsfall in aller Regel ohne besondere Probleme umgesetzt. Dennoch kann es an neuralgischen Stellen zu praktischen Konflikten zwischen den technisch-baulichen Vorschriften und der konkreten Situation vor Ort kommen.
Rauchschutztüren
Das sind Türen, die im Brandfall automatisch schließen, um zu verhindern, dass sich Rauchgase durch das Gebäude weiterverbreiten. Für körperlich eingeschränkte Personen kann diese sinnvolle brandschutztechnische Einrichtung ein absolutes Hemmnis darstellen. Um dennoch entkommen zu können, müssen Evakuierungskonzepte geeignete Schnittstellen resp. Fluchtwege berücksichtigen.
Treppenhäuser
Das Bauordnungsrecht fordert zwei voneinander unabhängige Fluchtwege. In öffentlichen Gebäuden sind das meist Treppen, die in zwei unabhängigen Brandabschnitten untergebracht sein müssen. Ausnahmen – etwa in Gebäuden mit Bestandsschutz – bedürfen besonderer bauordnungsrechtlicher Genehmigung. Treppen bzw. Stufen und Barrierefreiheit sind jedoch meist ein Widerspruch, d.h. für Rollstuhlfahrer oder Gehbehinderte kann das eigenständige Verlassen schwierig oder unmöglich sein. Auch das Tragen anderer Personen birgt Risiken: Helfer können sich körperlich übernehmen oder gemeinsam mit dem Eingeschränkten stürzen. Auch können räumliche Engpässe anderen Personen eine zügige und sichere Flucht erschweren.
Aufzüge Im Brandfall dürfen vorhandene Aufzüge nicht benutzt werden. Ausnahmen bilden nur eigens dafür ausgerichtete Brandschutz- bzw. Feuerwehraufzüge, die ein sicheres Verlassen des Gebäudes ermöglichen.
Alternative Lösungen (Auswahl)
Bereits im Planungsprozess sollten ergänzende Szenarien entwickelt und in der Umsetzung berücksichtigt werden. Dazu können Verhaltensvorschriften oder speziell eingerichtete Schutzräume gehören. Empfohlene Ansprechpartner sind die Feuerwehr oder die zuständige Brandschutzbehörde.
Anweisungen für das Betriebspersonal
Mitarbeiter kultureller Einrichtungen, z.B. Service- und Aufsichtskräfte, sollten informiert und geschult sein, alle Personen, die Unterstützung benötigen, kompetent und umsichtig betreuen und begleiten zu können. Dazu gehören geeignete betrieblich-organisatorische Anweisungen und regelmäßige Übungen für den Evakuierungsfall.
Wartezonen
An geeigneten Stellen auf den Fluchtwegen (z.B. an Übergängen zu benachbarten Brandabschnitten) können besonders markierte Bereiche eingerichtet werden, in denen sich Menschen mit Einschränkung sammeln, um mit Unterstützung ortskundiger Personen evakuiert zu werden.
Schutzräume
Das sind brandschutz- und lüftungstechnisch abgetrennte Bereiche innerhalb eines Gebäudes oder Geschosses, in denen Personen auf Hilfe durch die Feuerwehr warten müssen. In der Realität werden diese Bereiche jedoch allzu gern als Abstellräume missbraucht. Darüber hinaus ist der Aufenthalt in diesen Räumen im Katastrophenfall für viele Menschen eine psychologische Belastung.
Aufzüge
Abgesehen von der o.g. Ausnahme ist in Deutschland derzeit eine gesetzeskonforme Evakuierung von Personen über Aufzüge nicht möglich. Das war nicht immer so. Bis 2007 ermöglichte in Berlin die Verordnung über Rettungswege für Behinderte (BeRettVO) in Sonderbauten und unter bestimmten technischen Voraussetzungen den Einsatz von Aufzügen. Die Verordnung, die zumindest aus technischer Perspektive eine plausible Lösung vorsah, ist nicht mehr in Kraft, kann jedoch aus Sicht des Verfassers für bestimmte Anwendungsfälle zur Information herangezogen werden.
Fazit
Während die barrierefreie Zugänglichkeit öffentlicher Gebäude nach standardisierten Vorschriften geregelt und zunehmend umgesetzt wird, bleibt die Frage der Evakuierung von Personen – ob mit oder ohne Beeinträchtigung – überwiegend Gegenstand individueller Vorsorge.
Dieser Artikel erschien zuerst in der Zeitschrift Kulturbetrieb (www.kulturbetrieb-magazin.de) Ausgabe August 2014